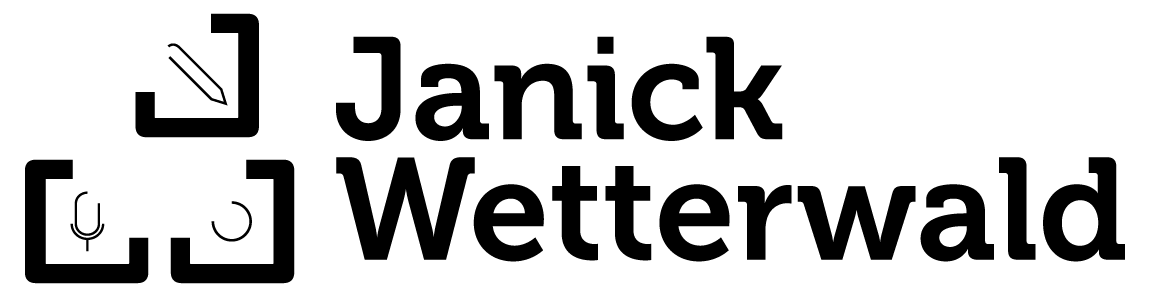Seit sechs Jahren hat die Nati ihre eigene aktive Supportergruppe. Die «Fankurve Schweiz» will auch mal rebellisch sein, aber der SFV hat da etwas dagegen. Ich war im Block mit dabei und auf Spurensuche.
Kopenhagen Ende März, in einem Pub im Zentrum der Stadt. Ich versuche mich unter eine Gruppe von Schweizer Natifans zu mischen. Ziel des Unterfangens: Ich möchte herausfinden, wer hinter der ominösen «Fankurve Schweiz» steckt.
Ihr grosses Banner fällt bei Heimspielen auf, das Internet liefert jedoch nur vage Eindrücke über die Gruppierung. Auf ihrem Instagram-Kanal sieht man Bilder von Capos mit Megafon, die Routen der Fanmärsche in London oder Rom, im Shop gibts Merchandisingartikel wie Jacken, T-Shirts, Sonnenbrillen oder Sticker. Die Website der «Freunde der Schweizer Fussballnationalmannschaften» – kurz Amici genannt – hält auch nur rudimentäre Informationen bereit. Die Amici sind ein in den 60er-Jahren auf Initiative des damaligen Trainers Karl Rappan gegründeter offzieller Fanklub, der heute vor allem aus Haupttribünengängern besteht.
Die «Fankurve» ist dort als neue Bewegung angegliedert. Eine Mitgliedschaft kostet 100 Franken. Damit verbunden sind Vorteile wie ein Vorkaufsrecht für Endrundentickets oder Rabatte für sonstige Natispiele, jene der Frauen sind für Mitglieder der «Fankurve» gar gratis. All das beantwortet aber die wichtigste Frage nicht: Was sind das für Leute, die an den Natispielen hinter dem Tor für Stimmung sorgen wollen? Warum tun sie das? Im März platzierte ZWÖLF eine erste Anfrage via «Freunde der Nationalmannschaften». Die Antwort fiel gleich aus wie bei 99 Prozent aller Fankurven auf Klub ebene – nämlich negativ. «Die Jungs haben sich über Ihre Anfrage gefreut, möchten aber diskret im Hintergrund bleiben», hiess es.
Diskret im Hintergrund bleibe ich auch in Dänemark. Die Nati-Superfans wollen offensichtlich nicht mit Journalisten reden, darum bleibt mir nichts anderes übrig. Ich will mir dennoch ein Bild vor Ort machen und erfahre dank Instagram den Treffpunkt. In einem Kommentar steht: «Wer nach Kopenhagen kommt: Wir treffen uns am Nachmittag im Proud Mary.»
Einen offiziellen Treffpunkt oder einen Fanmarsch wie bei den meisten Auswärtsmatches gibt es dieses Mal nicht. Nur wenige Schweizer sind für dieses Freundschaftsspiel angereist, knapp zwei Dutzend Fans finden sich rund drei Stunden vor Kickoff im Pub ein.
Manche von ihnen tragen Utensilien mit dem «Fankurve»-Logo. Die Stimmung ist gut, das Bier fliesst, es wird eifrig über Fussball diskutiert. Schafft der FC Thun den Aufstieg? Wie viele Auswärtsfahrer begleiten YB? Wieso kommen nicht mehr GC-Fans in den Letzigrund? Bald geht es auch um alte Geschichten aus der Schweizer Fanszene – Angebereien, Rangeleien, Schlägereien. Im Hier und Jetzt aber ist es friedlich. Es kommt auch zu einem Austausch mit einem ebenfalls in Rot gekleideten dänischen Anhänger. Man wünscht sich viel Glück und stosst zusammen an. Sobald die letzten Gläser leer sind, machen sich die Fans in Grüppchen auf zum Parken-Stadion. Wer nicht im Nati-Trikot unterwegs ist, trägt die rote «Fankurven»-Jacke. Ich bin mit meinem neutralen Outfit eher eine Ausnahme.
Yakin, Sommer und Co. werben für die Fankurve Schweiz
Auf der Instagram-Seite der «Fankurve Schweiz» wird rasch klar, dass die Fans den SFV mit an Bord haben. Nati-Stars machen Werbung in Video-Botschaften. «Hast auch du Lust, uns aktiv hinter dem Tor zu unterstützen? Werde jetzt Mitglied von der Fankurve Schweiz», sagt etwa Christian Fassnacht, und Murat Yakin ruft zur Carreise nach Andorra «für unser Land» auf.
Adrian Arnold, SFV-Mediensprecher, erklärt: «Wir haben mit Freude bemerkt, dass eine Fanszene rund um die Schweizer Nati entsteht. Darum ist es aus Sicht des Verbands klar, dass wir die Fankurve Schweiz in gewissen Bereichen unterstützen.» Mit Aktionen via Instagram will der SFV mithelfen, die «Fankurve» bekannter zu machen. Im Zentrum der Zusammenarbeit stehen aber die organisatorische Hilfe und die Koordination rund um die Nati-Spiele, für Busreisen, Treffpunkte, Fanmärsche oder Choreografien.
Der SFV versucht nach unserem Besuch in Kopenhagen und einer erneuten Anfrage, die Gruppe doch noch zu einer Auskunft zu bewegen. Tatsächlich tut sich etwas: Man will nun Fragen beantworten – allerdings nur schriftlich und anonym. 2018 sei die «Fankurve Schweiz» gegründet worden, lassen deren Exponenten verlauten. Sie sehen sich zuständig «für den organisierten Support, aber auch dafür, die Nationalmannschaft der fussballbegeisterten Bevölkerung wieder etwas näherzubringen».
Sie haben ähnliche Bewegungen im Ausland verfolgt, etwa die «Irresistibles Français» oder die «Hurricanes» in Österreich. Letztere hatten einen schweren Stand und Probleme bekundet, gerade was das Verhältnis zum Verband angeht. In der Schweiz zeigt sich ebenfalls: Durch die Zusammenarbeit mit dem Verband begeben sich die Fans auf einen Drahtseilakt.
Der SFV stellt für die Kooperation die klare Bedingung, dass die Aktivitäten in der allgemein anerkannten Norm bleiben. Arnold sagt: «Es soll nicht in Richtung Ultras gehen, wie man das vom Klubfussball kennt. Die Kurve hinter dem Tor soll bei Nati-Spielen nach wie vor für Familien und Kinder ein gefragter Platz bleiben. Und der zweite wichtige Punkt: keine Gewalt, kein Vandalismus, keine vermummten Personen, keine Pyros, keine Böller.»
Ein Blick auf einen Instagram-Beitrag der «Fankurve» von Juni 2023 lässt in diesem Zusammenhang aufhorchen: Eine rote Fackel prominent im Bild, dahinter zwei leicht vermummte Männer mit Rauchpetarden in der Hand, die vor einer Gruppe von Fans laufen. Das Foto ist rund um das Auswärtsspiel der Schweizer Nati in der EM-Quali gegen Andorra entstanden.
Der SFV schritt im Nachgang ein und bat die Verantwortlichen an den Gesprächstisch. Arnold sagt dazu: «Wir haben unsere Werte und Regeln nochmals klar gemacht. Wir haben uns offen und ehrlich ausgetauscht und alle wissen: Sollte es künftig zu Exzessen im Zusammenhang mit Pyros, Böllern oder Gewalt kommen, wird der Verband die Zusammenarbeit beenden.»
Die Kurve selbst stellt sich auf den Standpunkt, dass man «Personen, die andere gefährden oder massiv negativ auffallen» auch schon verwiesen habe, dass ein kontrolliertes Abbrennen von Pyros aber zum Fussball gehöre und man nicht die Aufgabe der Behörden übernehmen wolle. Auf anderen Bildern werden Gesichter verpixelt, auch dieses Recht wolle man sich nicht nehmen lassen.
Märsche, Pyros, Misstrauen gegenüber den Medien – all das klingt eben doch nach einer Fanszene aus dem Klubfussball oder zumindest nach einer, die so sein will. Die Verantwortlichen der «Fankurve Schweiz» mögen diesen Vergleich aber nicht. «Die Nationalmannschaft ist ein komplett anderes Territorium mit anderen Ansprüchen an die Fanszene und sehr vielen unterschiedlichen Fans aus unterschiedlichen Regionen», schreiben sie. Die 400 bis 500 Mitglieder seien stark durchmischt – auch Familien und Kinder seien darunter. Die Mehrheit habe einen Bezug zum Schweizer Klubfussball.
Harziger Support in Kopenhagen
Rund eine halbe Stunde vor Anpfiff haben sich die meisten Nati-Fans im Sektor hinter dem Tor eingefunden. In den ersten Reihen bildet sich eine kompaktere Gruppierung mit Fahnen, ansonsten verteilen sich die Leute im Sektor. Da der Familienvater mit der Walliser-Fahne, dort einige Jugendliche, für die es wohl eine ihrer ersten unabhängige Reise ist. Das Spiel beginnt: Die Stimmung ist gut, jedoch aufgrund der eher kleinen Zahl an Fans nicht überschwänglich. Aus der Gruppe vorne am Spielfeldrand heraus versucht hin und wieder ein Mann die restlichen gut 200 Fans mitzureissen. Er tut das auch in französischer Sprache: «Allez, tous ensemble!» Der Funke springt nicht über. «Alli Händ ufe! Los, das gad lüter!» Dieser Versucht scheitert ebenfalls – Kopfschütteln beim jungen Mann.
Im Vergleich zu einer Auswärtsreise im Klubfussball hat der Capo hier eher einen schweren Stand. Der Fankurve Schweiz ist das bewusst. Die Mitglieder kommen aus allen Landesteilen und sehen sich nur wenige Male im Jahr. «Kontinuität oder grosse Sprünge sind da schwierig», heisst es.
Ohnehin sieht sich die Fankurve eher als eine Art Fürsprecherin der Nati. Die Verantwortlichen bekunden nach eigener Aussage Mühe damit, wie das Team teilweise kritisiert wird. «Läufts schlecht, kippt die Stimmung, und in der Vergangenheit wurden vermehrt unsere Secondos dafür verantwortlich gemacht. Oft wird ihnen zu wenig Leidenschaft unterstellt und sie werden Opfer von rassistischen Parolen. Wir sehen uns deshalb auch als Vermittler», schreiben die Kurvenvertreter.
Inwiefern diese Worte aktiv gelebt werden, lässt sich bei meinem Besuch vor Ort nicht festmachen. Gegenteiliges – früher versammelten sich an Nati-Spielen auch mal Nationalisten – ist mir aber nicht aufgefallen. Ich will von der Fankurve wissen, wie ihr Wilhelm-Tell-Logo zu verstehen sei. «Wir wollten etwas, was die Schweiz verbindet», schreiben die Vertreter. Da werde «oft viel zu stark hineininterpretiert».
Die Tell-Sage handle von einem Freiheitskämpfer, der etwas verändert habe. So sehe man sich auch als Fankurve. Man wolle rebellisch daherkommen, aber auch etwas verändern. «Patriotismus ist für uns, kulturelle und geschichtliche Werte des Landes zu leben.» In ihren Zeilen heben die Verfasser den Wert der Secondos für die Entwicklung und Bereicherung der Schweiz hervor. Patriotismus bedeute auch, «Akzeptanz und Toleranz für Menschen mit Migrationshintergrund vorzuleben».
Vielleicht ist die Nati inzwischen ja wirklich ein Spiegelbild der heutigen Schweiz – auf dem Feld und auf den Rängen. Lange Zeit fremdelte gerade die urbane Schweiz mit der Unterstützung für Rot-Weiss. Wer in den letzten Jahren jedoch ein Public Viewing in den grossen Städten besuchte, merkte, wie sich dort die Begeisterung ausdrückte, gerade auch bei Schweizern mit Migrationshintergrund. Kommt hinzu, dass gerade jene, die das Nati-Fan-Sein verpönen, oft nicht mit gleichen Ellen messen. Der von Zehntausenden intonierte, übersteigerte Patriotismus anderer Nationen, zum Beispiel Argentinien, gilt dann plötzlich als bewundernswert.
Im Kopenhagener Parken-Stadion verhallen die sporadischen «Schwiizer Nati, allez allez» nach wenigen Metern. Das Geschehen auf dem Rasen hilft nicht, die Stimmung zu verbessern. Das von Vorsicht geprägte Spiel endet ohne grosse Aufreger 0:0. Die Mannschaft und der Staff bedanken sich artig vor der Kurve für den Support, ein Fan kriegt ein Shirt, danach verschwindet die Nati in der Kabine. Alles in Minne, die Vorfreude auf die EM überwiegt gegenüber der dürftigen Leistung in Kopenhagen. Es sind sogar «Wir fahren nach Berlin»-Sprechgesänge zu hören.
Alles gut nach dem Spiel – das war nicht immer so. Adrian Arnold erzählt, vom entscheidenden EM-Qualifikationsspiel in Ungarn gegen Israel: «Rund 35 Schweizer Fans waren vor Ort. Sie haben sich im Nachgang arg bei uns beschwert, dass die Mannschaft sich nicht vor der Kurve für den Support bedankt hat. Als Konsequenz mussten sich die Spieler beim nächsten Auftritt zum Teil Beschimpfungen anhören.» Diesen Zwist habe man mit einem Gespräch beseitigen können.
Auch hier gilt: Keine Ultras, aber ein bisschen eben doch. Sie sind noch in der Findungsphase, die Schweizer Nati und ihre Fankurve.