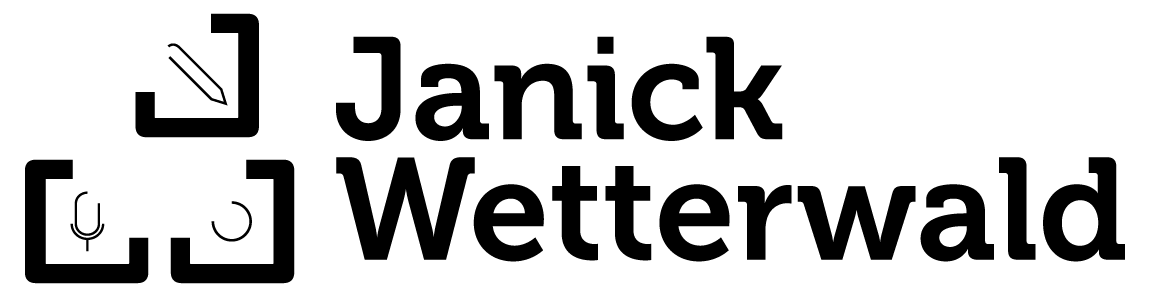Deutschland stellt gerade seine ganze Fussballstruktur auf den Kopf. Vieles hat sich der DFB von der Schweiz, also vom SFV, abgeschaut. Nun sehen Kritiker die alten Tugenden in Gefahr.
Deutschland steckt in einer monumentalen Krise. Die stolze und erfolgsverwöhnte Fussballnation blickt auf eine Bilanz des Schreckens zurück. Die Männer blieben zwei Mal in Folge in der Gruppenphase der WM hängen und scheiterten an der EM schon im Achtelfinal. Die U21-Auswahl reiste an der letzten EM nach der Vorrunde heim. Der hoch dekorierten Frauen-Elf passierte an der WM diesen Sommer das Gleiche.
Und die kleine, einst belächelte Schweiz? Das A-Team erreichte an den letzten drei WM-Endrunden den Achtelfinal, an der letzten EM gar den Viertelfinal. U21- und Frauen-Nati überstanden zuletzt ebenfalls ihre Gruppenphasen.
Dass der Nachbar mit bescheidenen Möglichkeiten viel herausholt, blieb in Deutschland nicht unbemerkt. Als der DFB kürzlich weitreichende Reformen präsentierte, dürften hierzulande einige geschmunzelt haben. Denn in den Rezepten, mit denen Deutschland die sportliche Baisse beheben will, steckt eine grosse Portion Schweiz.
Joti Chatzialexiou ist Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB und stark involviert in die Nachwuchsarbeit. Er sagt zu ZWÖLF: «Der Austausch zwischen DFB und SFV ist schon längere Zeit sehr gut. In den letzten Jahren haben wir den Kontakt intensiviert.» Es gab Besuche bei Super-League-Klubs wie YB, Luzern oder Basel, auch in Magglingen bei der Talentförderung schauten deutsche Delegationen vorbei. Man habe sich ein Bild machen wollen von der Arbeit in der Schweiz, sagt Chatzialexiou. Und spart nicht mit Lob: «In der Schweiz werden einige Dinge sehr gut gemacht. Es werden tolle Fussballer ausgebildet.»
Lob aus Deutschland, das Patrick Bruggmann stolz macht. Er ist Technischer Direktor beim SFV und bestätigt das rege Interesse der nördlichen Nachbarn. Er sagt, man stehe regelmässig in Kontakt. Zuletzt kam auch eine konkrete Anfrage: «Der DFB wünscht ein Treffen, bei dem alle Vertreter ihrer Leistungszentren anwesend sind.» Für Bruggmann ist das kein Problem: Man stelle gerne vor, wie die Nachwuchsarbeit hierzulande organisiert sei, und habe nichts zu verstecken. «Für uns ist das eine angenehme Situation, wenn Deutschland Interesse an unserer Strategie signalisiert.»
Manches bleibt geheim
Das Schweizer Erfolgsrezept, mit dem trotz kleinem Spielerreservoir schlagkräftige Nationalmannschaften formiert werden und das immer wieder junge Talente in Europas Top-Ligen bringt, wird den angeschlagenen Deutschen auf dem silbernen Tablett serviert? Nein, irgendwo ist dann genug mit Freundschaft. Bruggmann sagt: «Natürlich werden wir unser Erfolgsgeheimnis nicht bis ins letzte Detail ausbreiten.» Die Strategie könne ohne-
hin nicht eins zu eins übernommen werden, denn in jedem Land seien die Strukturen anders. Das sieht Chatzialexiou vom DFB ähnlich: «Wir müssen die erfolgreichen Strategien aus anderen Nationen sinnvoll auf unser Land adaptieren. Wieso bilden die Schweiz, Frankreich, Kroatien oder auch Holland besser aus als wir? Weil wir einiges in der Vergangenheit nicht gut gelöst haben. Die nun laufende Reform macht mir aber Hoffnung.»
Die Reform, die bereits im Herbst 2019 mit dem «Projekt Zukunft» lanciert wurde und nun Nachwuchsdirektor Hannes Wolf umsetzen soll, ist umfassend und betrifft sämtliche Altersklassen, angefangen beim Kinderfussball. In diesem Bereich hat Deutschland erstaunlicherweise einen Zug verpasst, der ursprünglich im eigenen Land gebaut worden war.
Die Spielform «Funino» ist eine deutsche Erfindung. Das Konzept, welches in der Schweiz seit dieser Saison flächendeckend eingesetzt wird, stellt die Spieler und ihre individuelle Entwicklung ins Zentrum. Es setzt mehr auf Spiel und Spass, der SFV hat ihm den Slogan «Play More Football» verpasst. Die Spieltage werden in Turnierform abgehalten – kleine Felder, kleine Teams, kleine Tore. Schiedsrichter: überflüssig. Tabelle: braucht es nicht. Das Spiel 7 gegen 7 auf das bekannte Feld gibt es weiterhin, wird nun aber ergänzt durch die oben erwähnten Spielformen.
«Das Ding kam in Deutschland damals nicht zum Fliegen. Wir in der Schweiz haben die Idee aufgeschnappt und viele Vorteile gesehen», sagt Bruggmann. Nun soll «Funino» auch in Deutschland die Weichen stellen. Die Trainingsphilosophie soll neu auf Spielformen ausgerichtet sein. In einem Land, das Fussballtraditionen besonders hochhält, ist es für einen Verband kein Leichtes, alte Muster aufzubrechen und neue, revolutionäre Ideen zu verkaufen. Gerade wenn das Verhältnis zwischen Amateurvereinen und Verbandsspitze fast schon traditionell angespannt ist.
Bevor du weiterliest präsentiere ich dir die tolle Illustration by Lukas Fuchs:

Welche Herkulesaufgabe dem DFB bevorsteht, zeigten schon die ersten Wochen nach Bekanntgabe der neuen Vorgaben. In Nordrhein-Westfalen wurde im Oktober ein Spieltag der F-Jugend abgesagt. Die Trainer weigerten sich schlicht, die neuen Spielformen anzuwenden. Im Breisgau wiederum wurde eine alternative E-Jugend-Liga ausserhalb des Verbands gegründet, wo weiterhin nach den alten Regeln und mit Tabellen gespielt wird. Joti Chatzialexiou nimmt Stellung zu kritischen Stimmen: «Der DFB ist von den neuen Spielformen überzeugt. Wir haben auf dem bisherigen Weg bereits viel Überzeugungsarbeit geleistet und müssen das weiterhin tun.»
Heftige Kritik gab es sogar aus den eigenen Reihen. DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke verspottete die Reformen und meinte: «Demnächst spielen wir dann noch ohne Ball. Oder wir machen ihn eckig, damit er den etwas langsameren Jugendlichen nicht mehr wegrollt.» Ähnliches bekam auch der SFV zu hören, als er Funino einführte, wie Patrick Bruggmann gesteht. «Es gab Leute, die sagten, das sei kein richtiger Fussball mehr.» Der Verband konterte mit nackten Zahlen.
Eine Studie der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Magglingen zeigte auf: Mit der Kombination von Partien auf Klein- und Grossfeldern verzeichnen die Kinder durchschnittlich 4,3 Spielaktionen pro Minute – also Ballannahme, Pass, Dribbling oder Abschluss. Mit dem bisherigen Format waren es nur 2,6. «Diese Zahlen haben den Vereinen die Augen geöffnet», weiss Bruggmann. Es sei aber auch wichtig gewesen, dass der Verband die Vereine bei der Umsetzung des neuen Konzepts unterstützt habe. «Wir waren vor Ort präsent und haben erste Turniere durchgeführt. Dabei wurde vielen Beteiligten bewusst, dass das eine gute Sache ist.»
Pädagogik durch Druck
In der erfolg- und titelreichen Ära von den 1970er- bis zu den 1990er-Jahren brachte Deutschland eine Reihe von grossen Fussballern mit spezifischen Tugenden heraus. Es waren fleissige, nimmermüde Arbeiter wie Berti Vogts, schmerzfreie Kämpfer wie Jürgen Kohler oder lautstarke Antreiber wie Oliver Kahn, der Niederlagen auch mal salopp mit «fehlenden Eiern» erklärte. Nur wer durch ein Stahlbad musste, hat die mentale Stärke, um auf höchstem Level zu bestehen, so die damals weitverbreitete Meinung.
In seinem Rundumschlag zeigte Hans-Joachim Watzke, wie präsent diese Haltung noch immer ist: «Wenn wir Angst haben, dass ein Achtjähriger komplett aus dem Gleichgewicht geworfen wird, weil er mal 0:5 verliert, dann sagt das sehr viel über die deutsche Gesellschaft aus.» Die grossen Triumphe und Titel, die Deutschland mit seinen ruchlosen Recken feierte, machen es für viele schwer, zu verstehen, wie nun plötzlich eine Wohlfühlatmosphäre und Kleinfeldgeplänkel ohne Druck für bessere Resultate sorgen sollen.
Der Druck soll nämlich auch im Spitzen-Juniorenfussball verschwinden. Eine weitere, kontrovers diskutierte Massnahme ist der Umbau der Stufen U17 und U19. Aktuell finden in der Junioren-Bundesliga nicht alle Teams der Leistungszentren einen Platz. Das bedeutet: Es herrscht knallharter Abstiegskampf, der Druck auf die Trainer ist gross.
Das bestätigt Orest Shala. Der U21-Trainer des FC St. Gallen war zuvor im Nachwuchs von Union Berlin tätig. Er sagt: «Heute müssen die deutschen Nachwuchstrainer zwingend Spiele gewinnen. Dieser Druck sorgt nicht immer für das beste Ausbildungsklima.» Wenn mehr auf Resultate als auf die Entwicklung der Spieler geachtet wird, kann das weitreichende Folgen haben, die später auch die Nationalmannschaften spüren. Ein Abstieg ist für die Vereine zudem doppelt schmerzhaft, weil dann viele Talente abwandern, um weiterhin auf höchster Stufe spielen zu können.
Diese Probleme kennt man in der Schweiz nicht. Der Nachwuchs der Profiklubs misst sich schon jahrelang in geschlossenen Ligen. Für die Klubs zählt nicht der Tabellenplatz, sondern die Förderung ihrer Talente, die dereinst das Fanionteam verstärken und später einen Transfererlös generieren sollen. Auch in diesem Bereich orientiert sich Deutschland an der Schweiz: In der nächsten Saison startet die DFB-Nachwuchsliga, in die alle Teams der 56 Leistungszentren eingegliedert werden. Der Weg ist frei für die individuelle Entwicklung der Spieler – ohne Abstiegsangst.
Diese Neuerung begrüsst Orest Shala sehr. Der Deutsche wünschte sich auch, dass sich sein Heimatland in anderen Bereichen die Schweiz als Vorbild nähme. «In Deutschland herrscht ein starkes Konkurrenzdenken unter den ambitionierten Vereinen, zum Beispiel in Berlin mit den zwei Aushängeschildern Union und Hertha. In der Schweiz hingegen arbeiten alle Vereine für das regionale Aushängeschild, hier in der Ostschweiz ist das der FC St. Gallen.»
Für die Nachwuchstrainer in Deutschland will Shala allerdings eine Lanze brechen: «In den Leistungszentren wird gute Arbeit geleistet. Die Trainer nehmen sich Zeit für die individuelle Entwicklung der Spieler.» Der Fokus werde allerdings in Deutschland nicht gleich stark auf die Ausbildung von eigenen Talenten gelegt. Seine Erklärung: «Die Bundesliga-Vereine sind mit ihrem internationalen Standing nicht so stark auf eigene Talente angewiesen wie die Super-League-Klubs.» Die Schweiz gehe im Vergleich zu Deutschland etwas konzeptioneller, mit einem klareren Plan vor.
Sorgfalt mit Talenten
Ein klarer Plan ist für ein kleines Land zwingend nötig. Man kann es sich schlicht nicht erlauben, Talente zu verlieren, sei es durch zu grossen Druck oder zu schlechte Betreuung. Für die Besten hat der Verband bereits vor über 15 Jahren das Programm «Footuro» ins Leben gerufen, mittlerweile gibt es auch das Pendant «Footura» für die Frauen.
Verein, Nachwuchsnationaltrainer und das SFV-Talentmanagement entscheiden über eine Aufnahme ins Programm, das ab Stufe U16 greift. Wer es dahin schafft, profitiert von einer umfassenden Unterstützung bei der Karriereplanung. Das heisst: individuelle Trainingspläne, zweimal jährlich Leistungstest in Magglingen und persönliche Betreuung durch SFV-Trainer sowie im Verein durch den Talentmanager. Aus den Reihen dieser Auserwählten soll dereinst der Nachschub für die Schweizer A-Nationalteams kommen.
2016 erfuhr das Programm eine wichtige Änderung: «Footuro»-Spieler müssen sich seither zu den heimischen Klubs bekennen. Der Verband will die Talente so lange im Land behalten, bis sie in der Super League zu Stammkräften gereift sind. Wer früher ins Ausland wechselt, profitiert nicht mehr von den Vorzügen des Programms. Künftig will der SFV noch mehr Wert auf die Betreuung seiner wertvollen Schätze legen. Dieses Jahr startet der erste Lehrgang zum Talentmanager – kein anderes Land bietet das an.
Die Klubs sind schon jetzt verpflichtet, diese Stelle auszufüllen, Bedingung war bislang lediglich ein
B-Jugend-Trainerdiplom. Nicht überall wurde deshalb zwingend den Fähigsten und Motiviertesten dieser Posten zugeschachert. Fortan braucht es dafür die neue Ausbildung. Damit will der SFV diese wichtige Position in den Vereinen weiter stärken und die Kompetenzen ausbauen.
Auch diese Entwicklung behält der DFB im Auge – und will nachziehen. Joti Chatzialexiou hat sich in Magglingen vor Ort ein Bild gemacht. Sein Fazit: «Die individuelle Förderung in der Schweiz läuft gut, und ‹Footuro› ist für uns sehr interessant.» Bruggmann lässt durchblicken: «Ein DFB-Vertreter will sich den neuen Lehrgang zum Talentmanager ganz genau anschauen kommen.» Zu Gast bei Freunden quasi – bis es auf dem Platz wieder um Sieg oder Niederlage geht.